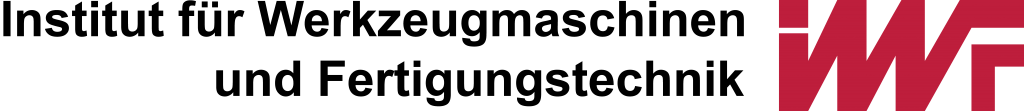Ein Blick hinter die Kulissen.
Warum es wichtig ist, die Motivation für Transformation in Niedersachsen voranzutreiben und Wie dazu die Qualifizierungsmaßnahme entstanden ist.
Die Arbeitswelt verändert sich rasant durch die Einführung von künstlicher Intelligenz, digitalen Produktionstechnologien und automatisierten Logistik- und Mobilitätskonzepten. Doch nicht nur die Digitalisierung bietet neue Herausforderungen für Unternehmen. Die Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen stellt Unternehmen vor eine schwierige Herausforderung, da sie gleichzeitig im globalen Markt erfolgreich bleiben müssen. In der Weltrangliste der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit verschiedener Nationen belegte Deutschland im Jahr 2020 von 63 Ländern lediglich Platz 14 in der Kategorie “wirtschaftliche Transformationsbereitschaft” (Weltwirtschaftsforum, 2020). Insbesondere kleine und mittelständische deutsche Unternehmen (KMU) stehen unter einem hohen Wettbewerbsdruck und müssen schnell innovative Geschäftsfelder aufbauen und die Digitalkompetenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wie steht es speziell um den Standort Niedersachsen?
Experten schätzen das verbleibende Zeitfenster, um dem Innovations- und Wettbewerbsdruck zu begegnen, auf 10 bis 20 Jahre ein (IAB, 2016). In Niedersachsen ist die Automobilindustrie ansässig, die eine Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen als Zulieferer umfasst. Laut dem Mittelstandsbericht des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (2019) sind 70% der Beschäftigten in KMU tätig, die 99,4% der niedersächsischen Unternehmen ausmachen. Jedoch sinkt der Anteil an innovativen KMU in Niedersachsen seit Anfang der 2000er Jahre stetig. Daher ist der Mut zur Veränderung für niedersächsische Unternehmen in den nächsten Jahren wichtiger denn je.
Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die Beschäftigungsverhältnisse?
Die Befürchtung, dass Maschinen oder Roboter viele Tätigkeiten ersetzen könnten, ist laut der Bundesagentur für Arbeit (2015) in den seltensten Fällen wirklich zu erwarten. Fast alle Berufe enthalten Tätigkeiten, die derzeit nicht durch Computer ersetzt werden können, so das IAB (2016). Experten des Weltwirtschaftsforums (2018) betonen, dass die wichtigste Frage für Unternehmen nicht die Anzahl wegfallender Arbeitsplätze durch Automatisierung ist, sondern wie sie optimale Bedingungen für eine gelungene Arbeitsteilung zwischen Technologie und Arbeitnehmer*innen schaffen können. Durch die digitale Transformation werden nicht nur bestehende Berufe stark verändert, sondern es entstehen auch neue Berufe. Laut IAB (2016) werden rund eine halbe Million neue Arbeitsplätze durch die digitale Transformation geschaffen. Es werden viele “Wechsel” zwischen Sektoren, Branchen, Berufen und Qualifikationen stattfinden (WEF, 2020). Für Niedersachsen ist es wichtig, diese Brücke zwischen wegfallenden und neu entstehenden Aufgabenfeldern durch fundierte Innovationsstrategien und Qualifizierungskonzepte zu meistern.

Der Strategiedialog Automobilwirtschaft in Niedersachsen
Eine Initiative, um Veränderungsmaßnahmen für Niedersachsen zu erarbeiten und anzustoßen.
Eine Maßnahme aus dem Strategiedialog
Angesichts dieser grundlegenden Veränderungen der Mobilitätsbranche und damit verbunden Herausforderungen entstand im Mai 2019 ein Strategiedialog Niedersachsen, der vom Land Niedersachsen, NiedersachsenMetall und der IG Metall Niedersachsen/Sachsen-Anhalt in Begleitung der Volkswagen Group und Continental initiiert wurde. Ziel dieses Dialogs ist es, den Automobilstandort Niedersachsen zu stärken, um Fachkräfte zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der Strategiedialog soll dazu beitragen, Transformationsprozesse zu begleiten, das Innovationspotenzial niedersächsischer Unternehmen zu nutzen und neue Wertschöpfungsprozesse, Mobilitätskonzepte und Qualifizierungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Dazu arbeiten Akteure aus ganz Niedersachsen in drei Innovatorenrunden eng zusammen. Univ.-Prof. Simone Kauffeld wurde in die Innovatorenrunde 3 (Arbeit und Qualifizierung) berufen. VeränderungsMacher*in entstand als Konzept aus dieser Innovatorenrunde und wurde intensiv in Zusammenarbeit mit Arbeitnehmer*innen- und Arbeitgeber*innenvertretern diskutiert und begleitet.
VeränderungsMacher*in – eine Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Multiplikator*in für die Transformation: Die Entwicklung einer groben Idee zum Anstoß einer weitreichenden Veränderung gelingt im Projekt VeränderungsMacher*in.
 |
|||
| Die Qualifizierungsmaßnahme bietet eine Antwort auf eine Befragung des Weltwirtschaftsforums (2020), die hervorbrachte, dass Innovation, Problemlösefähigkeiten, aktive Lernstrategien und Initiative weltweit von Unternehmen als einige der wichtigsten Fähigkeiten zum Unternehmensaufstieg bis 2025 angesehen werden. |
|||
Der Beirat der Qualifizierungsmaßnahme



Tobias Droßmann
Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen
Dr. Kirsten Anna van Elten
Industrie- und Handelskammer Braunschweig
Stefan Friedrich
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung



Dr. Norbert Gebbe
Innovationszentrum Niedersachsen GmbH
Michael Kleber
DGB-Region SüdOstNiedersachsen
Dr. Frederic Speidel
IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Carsten Trapp
Dämmtechnik Trapp GmbH

Prof. Dr. Thomas Vietor
Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik, Technische Universität Braunschweig
_________________________________________________
Quellen:
Bauer, Anja; Fuchs, Johann; Gartner, Hermann; Hummel, Markus; Hutter, Christian; Wanger, Susanne; Weber, Enzo; Zika, Gerd. (2021). IAB-Prognose: Arbeitsmarkt auf dem Weg aus der Krise. IAB-Kurzbericht, 06/2020. Nürnberg, 12 S.
Bundesagentur für Arbeit. (2015). Weißbuch: Arbeiten 4.0 – Antworten der BA auf die Herausforderungen der Digitalisierung. Nürnberg.
Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen. Regionale Fachkräftestrategie SüdOstNiedersachsen. Fortschreibung 2018-2021.
Leopold, Till; Ratcheva, Vesselina; Zahidi, Saadia. (2018). The Future of Jobs Report. Centre for the New Economy and Society. World Economic Forum.
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. (2019). Handlungskonzept Mittelstand und Handwerk. Hannover.
Schwab, Klaus; Zahidi, Saadia. (2020). The Global Competitiveness Report. World Economic Forum.
Wrobel, Martin; Buch, Tanja; Dengler, Katharina. (2016). Digitalisierung der Arbeitswelt: Folgen für den Arbeitsmarkt in Niedersachsen und in Bremen. IAB-Regional.
IAB Niedersachsen-Bremen. (2016). Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Nürnberg.
World Economic Forum. (2018). The Future of Jobs Report. Centre for the New Economy and Society.
Zahidi, Saadia; Ratcheva, Vesselina; Hingel, Guillaume; Brown, Sophie. (2020). The Future of Jobs Report. Centre for the New Economy and Society. World Economic Forum.